*** Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. ***
Schreiben lernt man durch Schreiben und Rechtschreiben lernt man nur, indem man die vielfältig geübten Regeln auch in den eigenen Schreibprozess integriert. Deshalb haben wir bereits in den Vertiefungsmöglichkeiten der Rechtschreibübungen immer wieder auf mögliche Schreibanlässe hingewiesen. In diesem Kapitel stellen wir einige weitere Anregungen zusammen.
Freies Schreiben – unabdingbar, aber risikoreich
Niemand lernt die Rechtschreibung nur durch Einzelübungen - genau wie niemand Klavierspielen nur durch Fingerübungen lernt. Deshalb ist das freie Schreiben für den Rechtschreiberwerb zwingend erforderlich. Gleichzeitig birgt es aber auch Gefahren, denn beim Schreiben konzentrieren wir uns für gewöhnlich auf den Inhalt, sodass wenig Aufmerksamkeitsressourcen für die Rechtschreibung übrig bleiben. Deshalb treten beim freien Schreiben oft Rechtschreibfehler (wieder) auf, die in den Übungen längst überwunden scheinen: Es sind die alten, automatisierten Routinen, die immer wieder durchschlagen und der Korrektur bedürfen.
Auswege aus dem Dilemma des freien Schreibens
Um von den positiven Effekten des freien Schreibens zu profitieren, ohne den problematischen zu viel Raum zu geben, helfen die folgenden Tipps:
- Machen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler immer wieder auf das Problem der Rechtschreibung aufmerksam und erläutern Sie Ihnen die Bedeutung der Aufmerksamkeitslenkung. Günstigstenfalls übernehmen die Schülerinnen und Schüler selbst die Verantwortung für ihre Rechtschreibung.
- Wählen Sie motivierende Schreibanlässe, aber nicht unbedingt solche, bei denen die Schülerinnen und Schüler völlig in ihren Inhalten versinken und die Rechtschreibung vergessen.
- Wählen Sie häufige, kurze Schreibanlässe, statt seltene, lange: Wer dreimal pro Unterrichtsstunde einen Satz schreibt, hat am Ende der Woche auch sein Übungspensum zusammen. Mit kurzen Übungen ist die Aufmerksamkeitsspanne immer frisch und die (Selbst-)Korrektur noch möglich. Außerdem vermeiden Sie Motivationseinbrüche bei schreibungeübten Lerngruppen.
- Achten Sie bei freien Texten stets auf Korrekturphasen (siehe Kap. Korrekturmöglichkeiten). Ziel muss nicht unbedingt sein, dass jeder Fehler gefunden und korrigiert wird, aber es muss zur Gewohnheit werden, dass Rechtschreibung eine Rolle spielt und beachtet werden sollte.
Lassen Sie ruhig zu, wenn Schülerinnen und Schüler sich inhaltlich und stilistisch ausprobieren und dabei auch mal über die Stränge schlagen. Kleine Provokationen wie etwa Schimpfwörter im Text verlieren rasch an Attraktivität, wenn sie ins Leere laufen und schriftsprachlicher Stil stellt sich mit zunehmender Erfahrung von selbst ein. Gerade am Anfang ist die Motivation wichtiger als die Richtigkeit – das gilt für Inhalt und Stil noch mehr als für die orthografische Form.
Schreibanlässe
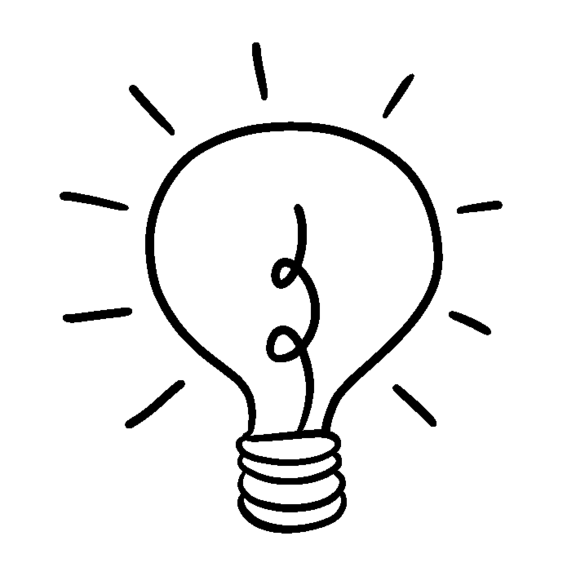
Wählen Sie ein Motiv, das auch eine emotionale Auseinandersetzung ermöglicht, z. B. das „Mädchen aus Afghanistan”, den „Schrei” von Eduard Munch oder Einsteins herausgestreckte Zunge. Lassen Sie das Bild entweder beschreiben oder eine kleine Geschichte dazu erfinden. Bei der Beschreibung ist Vollständigkeit weniger wichtig als die persönliche Auseinandersetzung. Die methodisch korrekte Vorgehensweise beim Bildbeschreiben kann auf den Kunstunterricht warten. Der Schreibanlass Bildbeschreibung eignet sich auch für Abbildungen und Grafiken, die im alltäglichen Unterricht auftauchen.
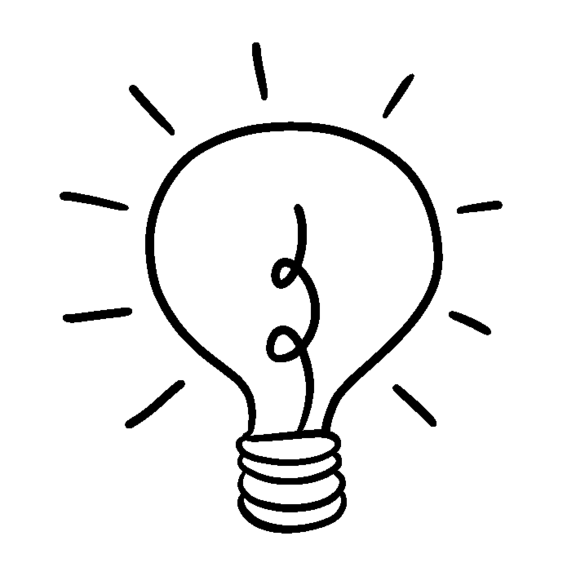
Nutzen Sie die Momente, nachdem Schülerinnen und Schüler einen Text, ein Gedicht oder ein anderes Material kennen gelernt haben, um erste Eindrücke schriftlich zu sammeln. Es genügen wenige Sätze, die nach der Niederschrift mit der Tischnachbarin / dem Tischnachbarn ausgetauscht werden. Meist trauen sich dann auch mehr Schülerinnen und Schüler, sich am Unterrichtsgespräch zu beteiligen.
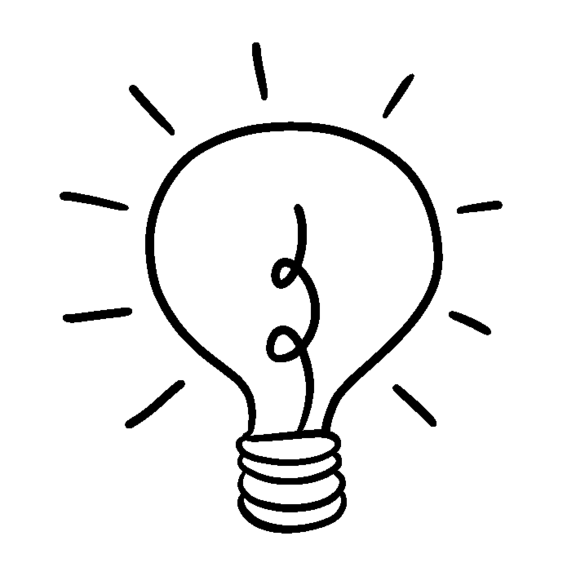
In vielen Situationen des Unterrichts geht es um die persönliche Einstellung und/oder Vermutungen zu einem Sachverhalt. Auch diese Momente eignen sich zu einer kurzen schriftlichen Reflexion, in der die Schülerinnen und Schüler sich ihrer eigenen Auffassung bewusster werden.
Lassen Sie die Meinung erst aufschreiben und kurz begründen, danach vielleicht zunächst austauschen (und korrigieren?), erst dann ins gemeinsame Gespräch tragen.
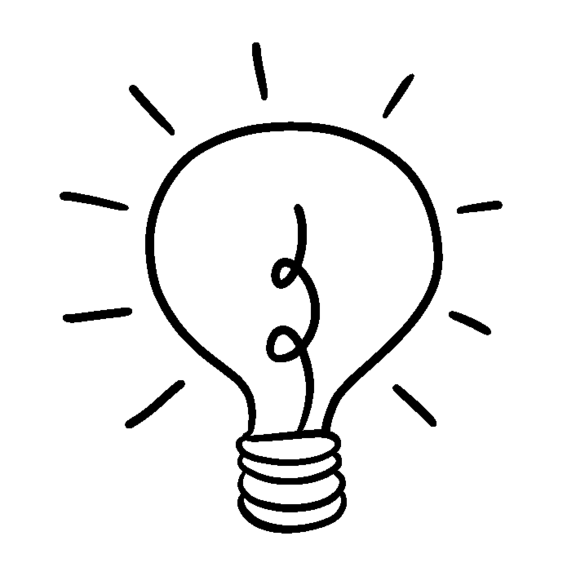
Viele erfolgreiche Lesetechniken setzen im ersten Arbeitsschritt auf die gezielte Voraktivierung von Wissen. Selbstverständlich kann das auch schriftlich geschehen. Dabei eignen sich Stichpunkte oder grafische Darstellungen mit Mindmaps sowie im Anschluss eine Sammlung an der Tafel. Günstigstenfalls tauchen hier schon die ersten Fachbegriffe auf, deren Rechtschreibung gesichert werden kann.
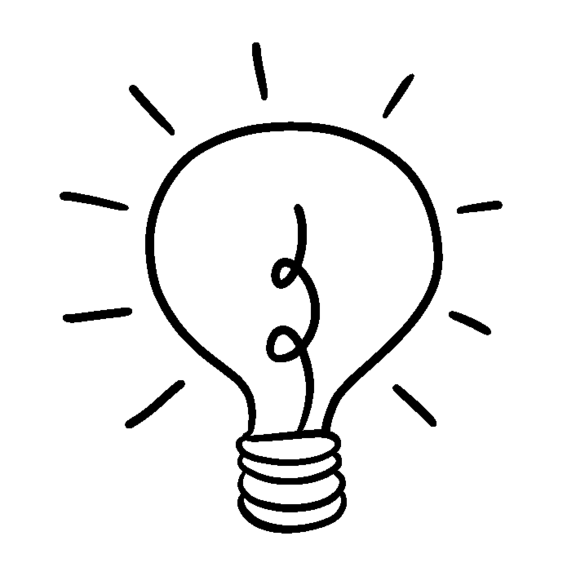
Schreibanlässe können auch der Selbstreflexion dienen. Eine kurze Beschreibung der persönlichen Stimmungslage, des bisherigen Tages oder der Erwartungen an die Woche helfen, sich seiner selbst bewusst zu werden. Da diese Schreibübung sehr persönlich werden kann, darf auf die Korrektur (ggf. ausdrücklich) verzichtet werden.
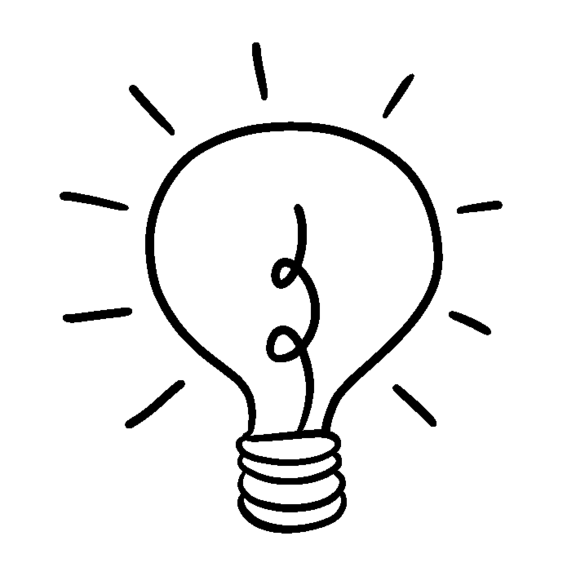
Egal, ob vor, während oder nach der Auseinandersetzung mit einer Thematik: Es ist immer wieder sinnvoll, die Fragen der Schülerinnen und Schüler an das Thema einzuholen, um sich ein inhaltliches Bild zu machen. Lassen Sie Fragen, Schlagwörter oder Stichpunkte an die Tafel schreiben. Noch anonymer geht es mit Internet-Angeboten wie Mentimeter & Co., bei denen die Äußerungen der Schülerinnen und Schüler direkt vom Smartphone aus an der Wand des Klassenzimmers projiziert werden. Rechtschreibrückmeldungen sind auch hier erwünscht, sollten aber nicht die Motivation zum Schreiben gefährden.
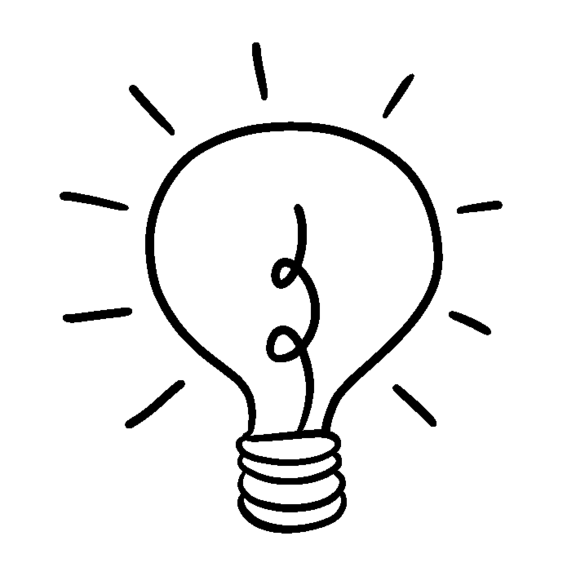
Niemand hat die alltägliche schriftsprachliche Kurzform so geprägt wie die sozialen Medien. Beispielsweise muss(te) man bei X/Twitter mit 280 Zeichen auskommen. Gerade Schülerinnen und Schüler, die das Schreiben scheuen, reagieren auf solche Beschränkungen positiv, weil sie den Aufwand überschauen können. Lassen Sie zu einem Thema Ihres Unterrichts einen Tweet verfassen, etwa, um die Meinung zum Thema einzuholen, eine Prognose zum weiteren Verlauf abzugeben oder Argumente auszutauschen. Mit kariertem Papier (2 x 7cm = 280 Kästchen) ist eine Kopiervorlage dazu rasch erstellt und kann regelmäßig eingesetzt werden.
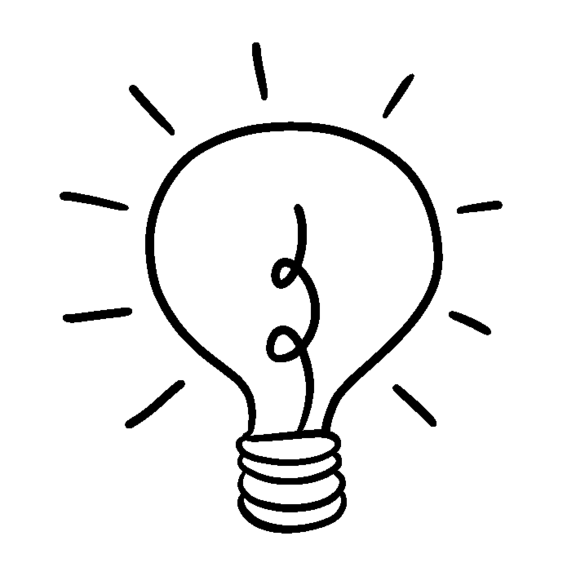
Noch kürzer geht es, indem Sie nur um die Schlagzeile einer Zeitung oder eines Internetbeitrages bitten. Dabei steht die extreme Kürze des Schreibprodukts im Kontrast zu dem Anspruch, das Thema auf den Punkt zu bringen und das Interesse der Lesenden zu wecken.
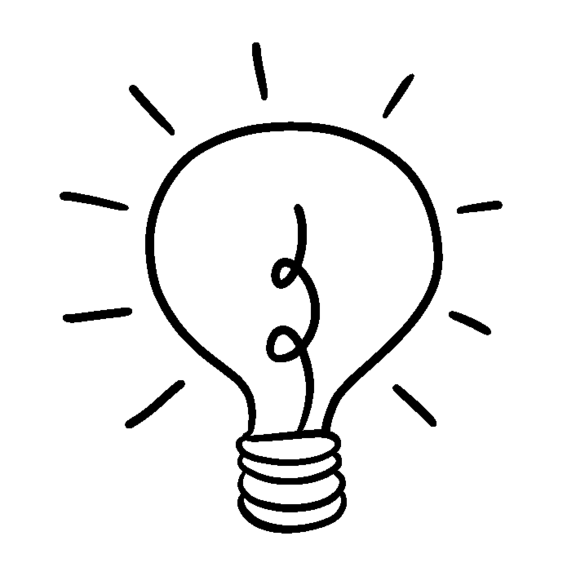
Fachunterricht lebt von der Kenntnis der Fachbegriffe. Dabei sind echte Definitionen eine wirklich anspruchsvolle Textsorte. Das muss aber nicht davon abhalten, das Definieren regelmäßig zu üben. Entscheidend ist nicht die Vollständigkeit, sondern die Selbstvergegenwärtigung. Zusätzlich erfahren Sie so, was und wie Ihre Schülerinnen und Schüler über die bereits erarbeiteten Inhalte denken.
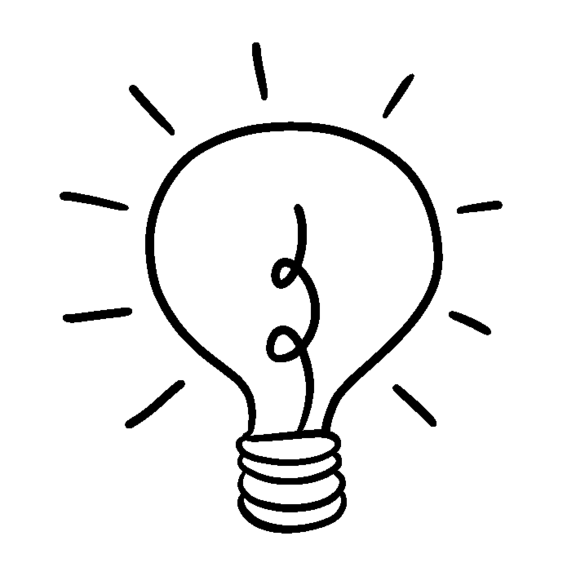
Lassen Sie zu einem Gegenstand eine kurze Beschreibung für ein Verkaufs- oder Anzeigenportal schreiben. Das nötigt die Schülerinnen und Schüler, genau hinzusehen, Informationen gezielt auszuwählen und treffsicher niederzuschreiben. Auch für die Beschreibung von Personen ist dieses Format geeignet, etwa bei Stellenanzeigen oder Partnerbörsen. Dabei ist unmittelbar einsichtig, warum hier die Rechtschreibung stimmen sollte, denn der Text wird zum Aushängeschild der eigenen Person.
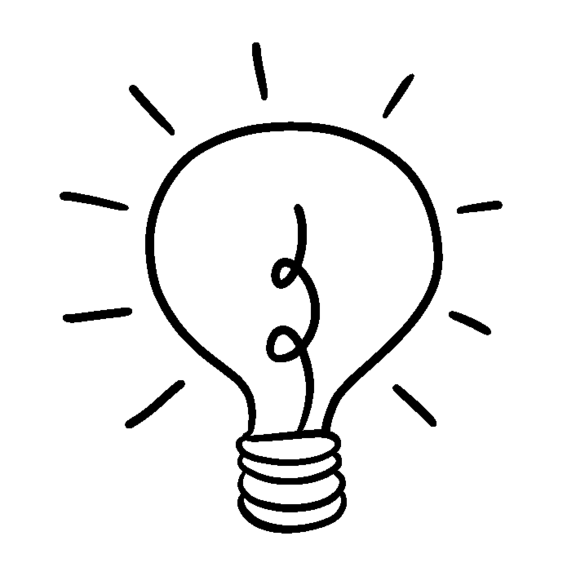
Gebrauchstexte des Alltags
Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler Einladungen, Ankündigungen oder kurze Ereignisberichte zu aktuellen Themen verfassen. Dabei muss es nicht immer nur ums Schulleben gehen: Auch in Jugendbüchern, Kurzgeschichten oder Balladen finden sich Anlässe, in die sich Schülerinnen und Schüler hineinversetzen können. Ganz nebenbei erlangt das Schreiben damit Relevanz für den Alltag der Lernenden.
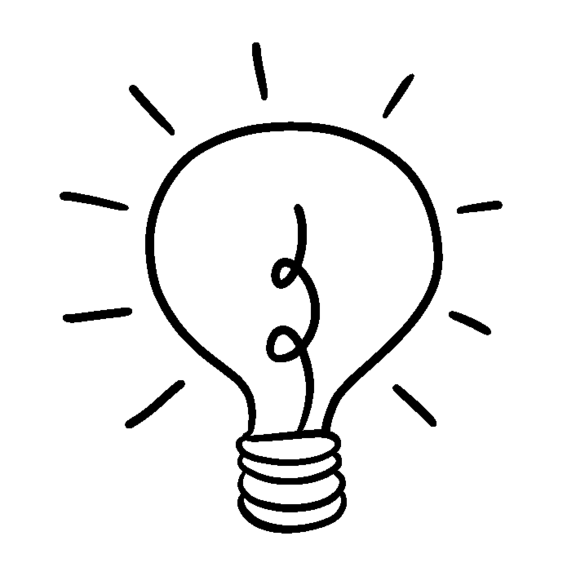
Benennungsspiele
Erstaunlich viele Dinge unseres Alltags sind allen bekannt, ohne einen allgemein verbreiteten Namen zu haben. Oder wüssten Sie, wie man die kurzen Plastikprofile nennt, die man an der Supermarktkasse zwischen den eigenen und den nächsten Einkauf legt, oder die Öffnungen vorn am USB-Stick, in denen die Kontakte liegen, und die man gefühlt immer verkehrt herum ausprobiert? Lassen Sie ihre Schülerinnen und Schüler doch einmal nach schönen Namen suchen und den zugehörigen Gegenstand schriftlich erklären.
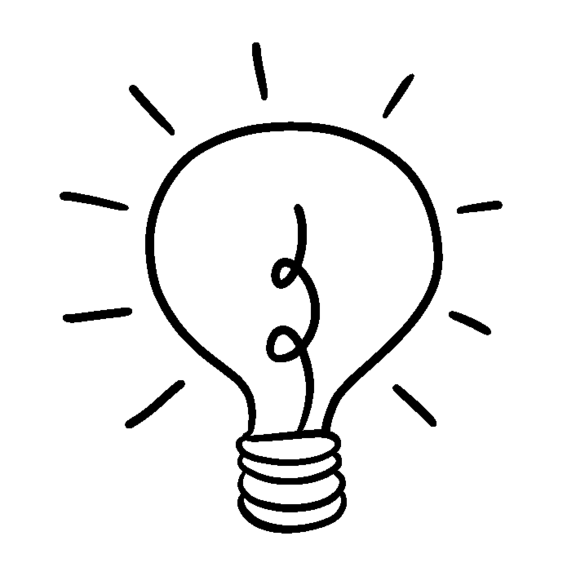
Exzerpte
Eine auch fachinhaltlich gewinnbringende Form des halbfreien Schreibens ist das stichpunktartige Exzerpt. Hier werden Textinhalte in geordneten Stichpunkten zusammengefasst. Diese Form des Schreibens bringt nicht nur den Vorteil, dass das Abschreiben komplizierter Wörter die Fehlerrate verringert, sondern der Lerneffekt geht auch weit über das Rechtschreiben hinaus, weil das Exzerpt die Auswahl, Gewichtung und Umformulierung von Textinhalten erfordert. Damit ist diese Übung viel anspruchsvoller, als sie auf den ersten Blick erscheint, und benötigt viel Übung, die sich mit der Zeit aber auszahlt.
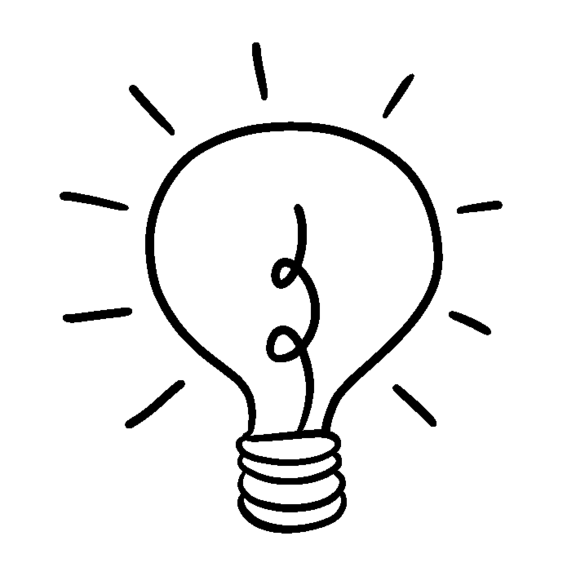
Texte ausschmücken
Das Gegenteil zum Exzerpt geschieht, wenn vorgegebene Texte gezielt ausgeschmückt und dadurch gestaltet werden. Dazu eignet sich die digitale Form besonders gut, aber auch auf dem Papier lassen sich vorgegebene Kurztexte durch Einfügung von Adjektiven, beschreibenden Wortgruppen oder ganzen (Neben-)Sätzen neu gestalten. Zur Königsklasse wird diese Übung, wenn sich dabei gezielt eine neue Textsorte ergibt – etwa eine literarische Beschreibung, die aus einem Zeitungstext entstanden ist.
Redaktionell verantwortlich: Jan Steckmeister
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.

