*** Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. ***
Die Korrektur ist der Dreh- und Angelpunkt des Rechtschreiblernens und gleichzeitig das Generaldilemma aller Deutschlehrkräfte. Denn ohne die stetige Rückmeldung, was richtig war und was nicht, können Lernprozesse nicht stattfinden.
Aber wer jede schriftliche Äußerung seiner Schülerinnen und Schüler mit einer konstruktiven Korrektur versehen wollte, kann seinen Feierabend auf das nächste Leben verschieben.
Was sinnvoller Rechtschreibunterricht braucht, ist folglich eine gesunde Balance aus regelmäßiger Korrektur und Beschränkung des Arbeitsaufwands. Im Folgenden haben wir Ihnen einige Möglichkeiten zusammengestellt. Keine davon ist ohne Nachteil oder könnte das geübte Auge der Fachlehrkraft ersetzen, aber in geschickter Kombination und bei regelmäßigem Einsatz in der Lerngruppe können sinn- und wirkungsvolle Lernszenarien mit angemessener Leistungsrückmeldung zusammenkommen.
Korrekturmöglichkeiten
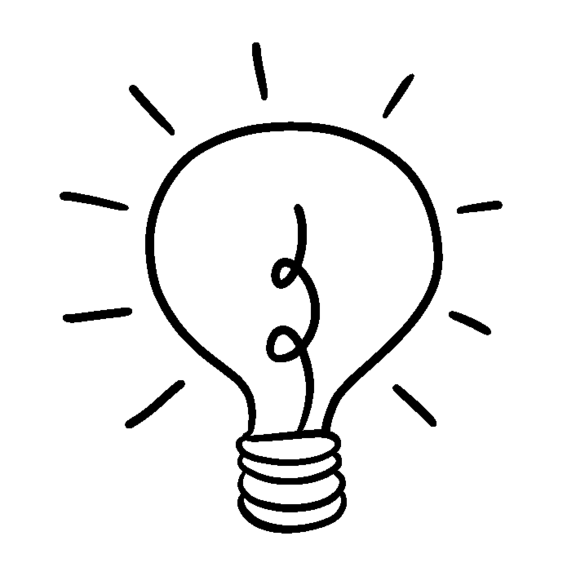
Viele Lehrkräfte klagen, dass ihre Schülerinnen und Schüler die eigenen Fehler nicht sehen. Das ist in der Regel auch tatsächlich der Fall. Dennoch kann Selbstkorrektur einen sinnvollen Beitrag zum Rechtschreiberwerb leisten. Dazu muss sie allerdings ihrerseits eingeübt werden, denn auch das Sehen von Rechtschreibfehlern braucht Übung und Aufmerksamkeit. Oft helfen die folgenden Hinweise weiter:
- Räumen Sie gezielt Zeit zur Selbstkorrektur ein. Bei längeren Schreibphasen sollte ca. ein Fünftel der Arbeitszeit für die Rechtschreibkorrektur vorgesehen werden. Weil viele Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit lieber weiterschreiben würden, kann das erreichte Textende durch einen roten Strich beendet werden, sodass eine Weiterarbeit nicht möglich ist.
- Da selbst gefundene Fehler das höchste Lernpotenzial haben, kann es sinnvoll sein, die Motivation zum Finden zu erhöhen – etwa, indem jeder selbst gefundene Fehler zusätzlich einen übersehenen ausgleicht. Lassen Sie dazu gezielt mit einer anderen Farbe korrigieren, um die Umarbeitung nachvollziehen zu können.
- Beenden Sie jeden kurzen Schreibanlass durch eine Minute Zeit für Selbstkorrektur und fordern Sie auch gezielt zum Rückfragen auf. Der Einsatz von „Jokern”, mit dem die Schülerinnen und Schüler ein Wort nachfragen dürfen, hilft dabei, die Metakognition zu stärken, also das Wissen über das eigene Wissen.
- Selbstkorrektur gewinnt an Effizienz, wenn in jedem Korrektur-Durchgang die Aufmerksamkeit auf einem anderen Aspekt der Rechtschreibung liegt. Sinnvoll ist es etwa, den eigenen Text einmal bewusst mit der Artikelprobe auf Groß- und Kleinschreibung zu testen, einmal mit der Klangprobe auf lange und kurze Vokale und einmal mit dem Nebensatz-Schnelltest auf die Kommasetzung.
Ein wenig Gewöhnung benötigen Korrekturpausen, bei denen die Arbeit am Text in regelmäßigen Abständen unterbrochen wird, um das bisher Geschriebene zu korrigieren. Das reißt aus der aktuellen Textarbeit heraus und wird deshalb mitunter nur unwillig angenommen. Andererseits dient es der Selbstorientierung im eigenen Text und trainiert die Fähigkeit, neu anzusetzen und weiterzuarbeiten.
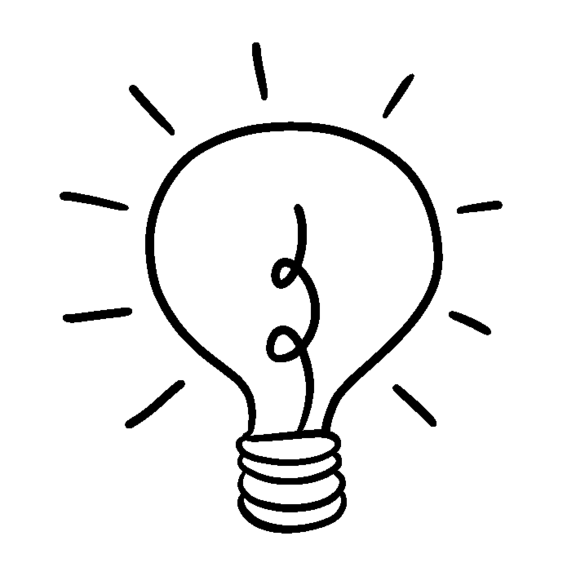
Sofern Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern keine freien Texte, sondern vorgegebene Übungen zu korrigieren haben, lohnt es sich, die richtige Lösung nicht nur zur Verfügung zu stellen, sondern auch gezielt zu kommentieren und dabei die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf typische Fehlerschwerpunkte zu lenken. Damit lässt sich die Effizienz der Selbstkorrektur erheblich steigern.
Eine weitere Möglichkeit bietet die Arbeitsteilung, in der zwar die Korrektur der Lehrkraft nicht völlig entfällt, aber erheblich vereinfacht wird: Streichen Sie in den Texten Ihrer Schülerinnen und Schüler nur diejenigen Zeilen an, in denen sich Rechtschreibfehler befinden, sodass die Aufmerksamkeit gelenkt wird und die Schülerinnen und Schüler nach problematischen Schreibungen suchen können. Ist auch das noch zu schwer, hilft es vielleicht, die problematischen Wörter mit einem roten Punkt zu versehen, um die Schülerinnen und Schüler nach der korrekten Schreibung suchen zu lassen. Positiv an beiden Korrekturformen ist, dass dabei nicht nur die Fehler, sondern auch alle richtigerweise als richtig erkannten Wortschreibungen vertieft werden.
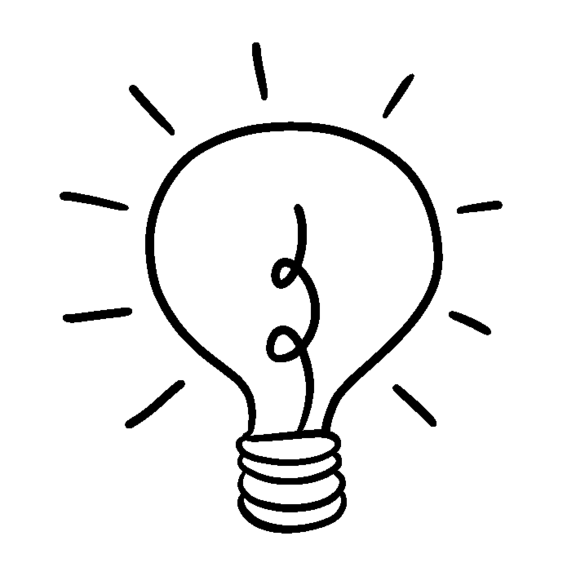
Einen wichtigen Faktor in der Selbst- und Fremdkorrektur bildet die Möglichkeit, einmal gemachte Korrekturen erneut nachvollziehen zu können. Deshalb ist es sehr sinnvoll, Rechtschreibfehler in Fehlertagebüchern zu sammeln und daraus regelmäßig individuelle Schreibübungen abzuleiten (vgl. Methode Rechtschreibportfolio). Als Gliederung bietet es sich an, nach Einzelphänomenen vorzugehen, wobei die Einteilung in die vier großen Teilbereiche der Rechtschreibung (Laute und Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung sowie Zeichensetzung) einen guten Anhaltspunkt gibt. Achten Sie aber beim Führen des Fehlertagebuches darauf, dass die Schülerinnen und Schüler den Sinn der Sammlung verstehen und es nicht als „gesammelte Niederlagen” wahrnehmen.
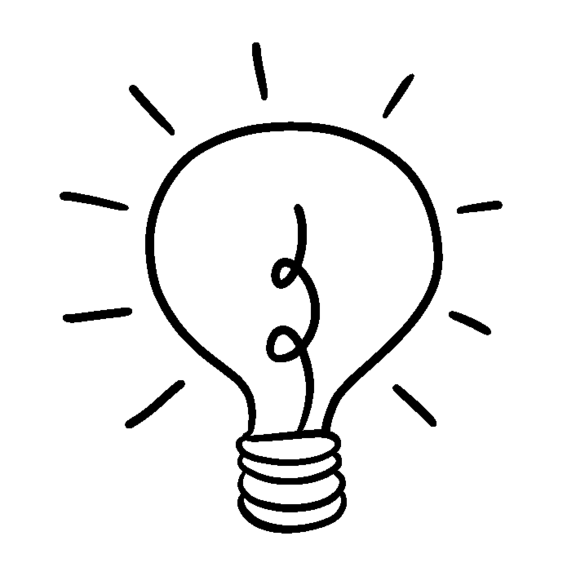
Es ist eine alte Weisheit, dass man die eigenen Fehler viel weniger sieht als die der anderen. Aber was im sozialen Bereich zu Spannungen führen kann, hat in der Rechtschreibung konkrete lernpsychologische Ursachen und kann zur Einsparung von Korrekturaufwand sowie zur Vertiefung des Lerneffektes verwendet werden. Dabei tauschen die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit mit einer Partnerin / einem Partner aus und suchen gegenseitig nach Rechtschreibfehlern, die sie einander zurückmelden.
Das ist zwar längst nicht so gründlich wie die Korrektur durch einen orthografischen Profi, hat aber einige wertvolle Vorteile:
- Die Korrektur erfolgt rascher als durch die Lehrkraft und kann damit lernpsychologisch effizienter erfolgen.
- Durch das höhere Vertrauensverhältnis zwischen den Mitschülerinnen und Mitschülern ist die Korrektur weniger selbstwertbelastend und leichter anzunehmen.
- Der Korrekturprozess selbst birgt einen Lerneffekt, denn er nötigt zur vertieften Auseinandersetzung mit einer Fülle an Wortschreibungen und trainiert damit ebenfalls das Mustergedächtnis.
Die unvollständige Auswahl zurückgemeldeter Fehler ist nicht immer nur ein Nachteil: Da es sich in der Regel um die auffälligsten Fehler handelt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass genau diese in der „Zone der nächsten Entwicklung” (Wygotski) liegen, wo die größten Chancen vorhanden sind, alte Muster abzulegen und durch neue zu ersetzen.
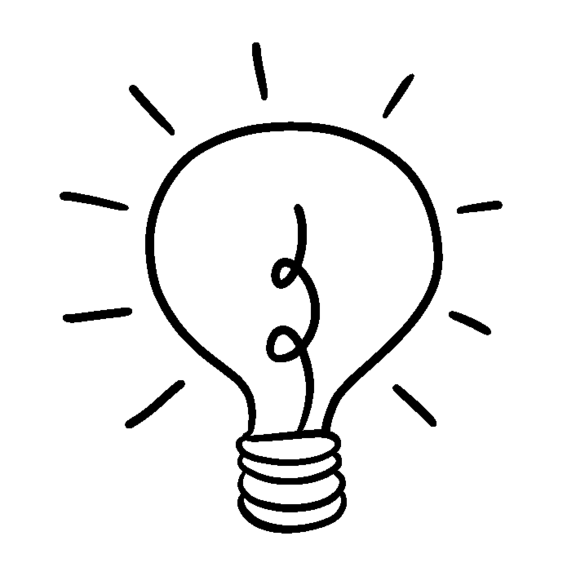
Rechtschreibübungen am Computer, Smartphone oder Tablet profitieren ohnehin vom unmittelbaren Feedback, das die Programme geben können. Aber auch beim freien Schreiben kann die Rechtschreibkorrektur des Textverarbeitungsprogramms gute Dienste leisten und eine sinnvolle Rückmeldung geben. Dabei ist allerdings auf einige Punkte zu achten:
- Viele Lehrkräfte haben Vorbehalte gegen die automatische Fehlerkennzeichnung, weil sie sie als eine Art „Vorsagen” missverstehen. Diese Auffassung ist allerdings lernpsychologisch wenig stichhaltig, wenn man sie ins Verhältnis zum Vorteil der sofortigen Rückmeldung stellt. Scheuen Sie sich also nicht, die automatische Fehlerkennzeichnung zuzulassen.
- Eine viel problematischere Schwierigkeit liegt darin, dass sich Schülerinnen und Schüler rasch an die roten Schlangenlinien gewöhnen und ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Hier sollten Sie gegensteuern und die Schülerinnen und Schüler auffordern, die programmierte Rückmeldung ernst zu nehmen und gezielt nach den Fehlern zu suchen. Irrtümlich unterstrichene Begriffe wie Eigennamen oder Abkürzungen, die das Rechtschreibprogramm nicht kennt, sollten mit „ignorieren” oder „zum Wörterbuch hinzufügen” getilgt werden.
Nicht jeder scheinbare Fehler ist wirklich einer und nicht jede angebotene Fehlerkorrektur ist wirklich besser. Gerade bei der Getrennt- und Zusammenschreibung patzen viele Rechtschreibprogramme, weil sie die Zusammensetzung nicht kennen. Weisen Sie auf dieses Problem hin und halten Sie Ihre Schülerinnen und Schüler an, der Korrektur nicht blind zu vertrauen, sondern sie als Anlass zur Auseinandersetzung und gezielten Prüfung anzusehen.
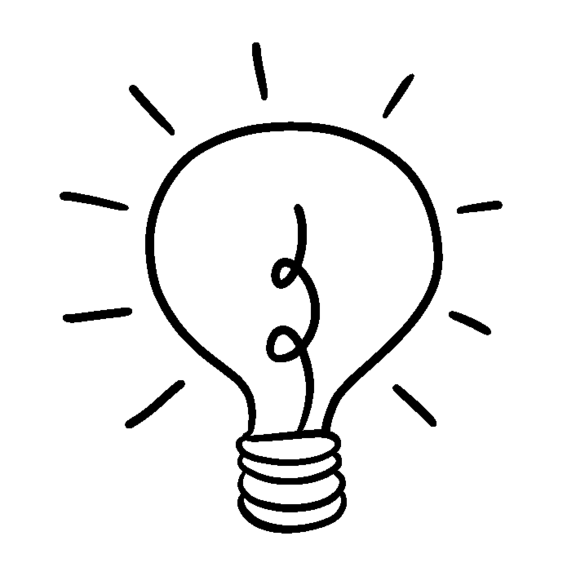
Eine besondere Form der Rechtschreibkorrektur ist erst in jüngster Zeit durch Chatbots und Künstliche Intelligenz möglich geworden. Obwohl KI-basierte Sprachmodelle noch nicht gänzlich fehlerfrei arbeiten, lohnt es sich sehr, den Text mit der Aufforderung zur Rechtschreibkorrektur an eine Künstliche Intelligenz weiterzureichen. Die Programme sind den klassischen Rechtschreibkorrekturen bereits haushoch überlegen und erläutern auf Wunsch auch die Rechtschreibfehler genauer.
Redaktionell verantwortlich: Jan Steckmeister
Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg ist ein Service des Landesinstituts Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Berlin) und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg.

